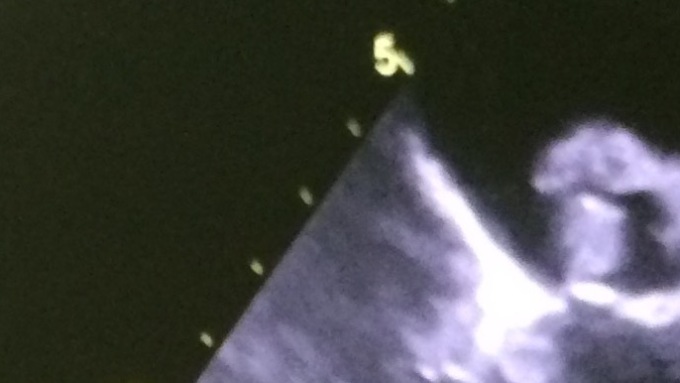Mit dem Thema HIV und AIDS habe ich mich schon vor Jahren erstmals befasst, durch ein Jugendbuch, in dem sich eine damals 15jährige (und das war für mich alt – was war ich jung!) in… Mehr
Wie schwierig es unsere Patienten haben (und warum es gut ist, ab und an selbst Patient zu sein)
Zum Glück muss ich nur selten zum Arzt, und wenn, dann meist zur Vorsorge oder Impfung. Letzte Woche war es jedoch wieder so weit – der Arztbesuch war leider nicht schön, aber die Erfahrung für mich umso wichtiger: Zu schnell vergisst man als Mediziner, welches Gewicht die eigenen Worte haben.
Ein Routinebesuch wird zur Achterbahnfahrt
Eigentlich hatte ich den Termin beim Gynäkologen nur vereinbart, um mich selbst zu beruhigen – und weil die letzte Vorsorge auch schon etwas her war. Aber die vaginale Pilzerkrankung hatte ich mir bereits selbst diagnostiziert (Jucken, Ausfluss, „häufiges ist häufig“), und mit der Therapie begonnen. Als ich bei der Terminvergabe hörte, dass sich ein neuer Kollege um mich kümmern würde, war ich zwar nicht begeistert aber dachte mir, was soll’s – zumindest hatte ich einen Termin für den nächsten Tag.
Ein Vertrauensverhältnis aufzubauen braucht Zeit
Aufgrund mehrerer Umzüge habe ich in den letzten Jahren viele verschiedene Gynäkologen besucht, denn meine Krebsvorsorge nehme ich ernst (und irgendwo muss man das Pillenrezept ja herbekommen). Angenehm ist der erste Besuch nie, schließlich kennt man sich nicht und die Untersuchung ist intim. Aber es gibt große Unterschiede.
Der neue Arzt wirkt nett, versteht schnell mein Problem, schnell bestätigt er mir die Pilzerkrankung und die Therapie. Ich fühle mich gut aufgehoben. Zuerst. Dann beginnt die Verunsicherung. „Sie haben eine Ektopie.“, erklärt er mir mit ernster Stimme bei der gynäkologischen Untersuchung, „da muss man mal einen HPV-Test machen.“ Meine Gedanken rasen, Ektopie – das ist doch etwas ganz normales? HPV… dagegen bin ich geimpft (zumindest Untergruppen 16 und 18, die krebserregend sind), und außerdem habe ich weder Kondylome bemerkt und auch sonst keine Beschwerden? Und der letzte HPV Test war doch negativ? „Haben Sie chronische Entzündungen gehabt? Chlamydien oder so?“, geht es weiter – schnell verneine ich. Gleichzeitig beginne ich, mir Sorgen zu machen. Sieht der Herr Doktor gerade irgendetwas, was auf eine zurückliegende Entzündung hinweisen könnte? Habe ich da etwas nicht mitbekommen? Ab und zu zwickt es im Unterbauch ja schon…
Kommunikation ist das A und O
Leider bleibt es nicht dabei, bei der vaginalen Ultraschalluntersuchung erklärt mir mein Arzt sehr nett, was er sieht (er weiß inzwischen, dass ich bald eine Kollegin sein werde), sagt aber leider zu viel: „Hier ist die Gebärmutter nicht ganz scharf abgegrenzt, sehen Sie, das könnte eine Endometriose sein.“ Was? Endometriose? Hab ich nicht, hatte ich noch nie, will ich nicht! Als er mir dann auch noch eröffnet, dass er meine Eierstöcke, die sich vor drei Jahren ohne Probleme haben darstellen lassen, nicht finden könne, und dass dies an Verwachsungen liegen könnte, ist es um mich geschehen. Gerade habe ich Gyn gelernt für’s Staatsexamen, da heißen chronische Entzündungen = mögliche tubuläre Verwachsungen = bin ich womöglich steril???
Dabei meint es der Arzt nicht böse, da bin ich mir sicher. Er nimmt sich Zeit, mir das Abtasten der Brust genau zu erklären, betont, dass es ihm egal sei, ob seine Patientinnen die IGeL (individuelle Gesundheitsleistung, werden von der Kasse nicht bezahlt) bezahlen können oder nicht – wenn er es für sinnvoll hält, führt er diese dennoch durch. Prinzipiell eine sympathische Einstellung. Aber übertreiben sollte man es deswegen nicht: Kurz darauf diagnostiziert er mir per Ultraschall eine Narbe in der linken Brust („Haben Sie sich da mal gestoßen?“) sowie eine Mastopathie. Vielen Dank, auf diese zwei Diagnosen hätte ich verzichten können.
Manchmal will man nicht alles wissen
Es ist sicher nicht leicht, es jedem Patienten recht zu machen. Jeder Mensch geht anders mit Zweifeln um, hat einen anderen Wissensbedarf; und nur weil man Medizin studiert, möchte man nicht unbedingt über alle Auffälligkeiten des eigenen Körpers Bescheid wissen (zumindest nicht über die, die keine Beschwerden verursachen und nicht gefährlich sind). Auch die Umstellung zwischen der Arbeit im Krankenhaus und in der Praxis ist sicherlich groß; die Patienten kommen mit anderen Problemen und Ansprüchen.
Als frisch Niedergelassener muss man einiges anders machen als in der Klinik. Die Gynäkologin, zu der ich nach drei schlimmen Tagen voller Zweifel und Sorgen gehe, begreift die Situation sofort. „Was, das alles hat er Ihnen gesagt? Aber die Hälfte der Frauen in Ihrem Alter haben eine Ektopie. In der Praxis muss man schnell sein, entscheiden, was abzuklären ist und die Patientinnen beruhigen. Wenn er so weitermacht überlebt er in seiner eigenen Praxis nicht.“ Nun geht es an’s Eingemachte, die Ultraschalluntersuchung. „Sehen Sie, hier liegen Ihre Ovarien, genau da, wo sie sein sollen. Vielleicht lag es am Sonogerät, dass sie sich schlecht darstellen lassen. Wenn Sie nie Probleme hatten ist es sehr unwahrscheinlich, dass da irgendetwas verwachsen ist. Sie behandeln jetzt erstmal die Candidose, und wenn es dann noch Probleme gibt, kommen Sie wieder. Und falls nicht, sehen wir uns zur nächsten Vorsorge“.
Fehlendes Feedback in der Medizin
Als ich die Praxis verlasse, fühle ich mich erleichtert. Ein paar unüberlegte Worte haben mir schlaflose Nächte und eine innere Unruhe bereitet, die wirklich unangenehm war. Ich konnte mich gar nicht auf’s Lernen konzentrieren! Dann frage ich mich, inwiefern ich dem Arzt eine Rückmeldung geben kann. Als Patientin will ich nicht wieder zu ihm, aber kann ich ihm mitteilen, warum? Damit er daraus lernen kann? In der Wirtschaft ist Kundenfeedback oft willkommen und wird ermutigt, bei einem niedergelassenen Arzt habe ich so etwas noch nie institutionalisiert gesehen. Schade eigentlich.
E-Learning: Wie haben die das früher nur gemacht?
Wenn man beim Pinkeln in Ohnmacht fällt, dann heißt das „Miktionssynkope“. Was, noch nie davon gehört? Ich auch nicht – bis heute, da hat sich das dank Amboss geändert. Das webbasierte Lernportal der Firma Miamed hat seit seiner Gründung 2011 ganz still und heimlich die Mediziner-Examensvorbereitung revolutioniert: ein gut strukturierter Lernplan mit Lernkarten, die alle für das Examen wichtigen Krankheitsbilder abdecken, kombiniert mit Altfragen der vergangen Examina und jeder Menge Verlinkungen, Bilder, Skizzen, Fotos, Lehrvideos, weiterführenden Weblinks. Alles, was man heutzutage braucht, um sich auf das 2. Staatsexamen vorzubereiten, wird uns auf dem goldenen Tablett serviert. Ich muss noch nicht einmal planen, wann ich was lerne – 100 Lerntage sieht der Examensplan vor, und ich gehe sie einfach eins nach dem anderen durch.
Viele ältere Mediziner-Generationen kennen wahrscheinlich noch die schwarze Reihe
Mit Büchern lernt heute kaum mehr jemand von uns Medizinstudenten. Zumindest nicht für das Examen. (Nur der Anatomie-Atlas konnte bisher noch nicht digitalisiert werden! Aber den brauch ich zum Glück auch nur noch sehr selten…) Sicher, die Universitätsbibliothek hat auch noch jede Menge Bücher und Zeitschriften zur Ansicht. Aber nur selten sehe ich Studenten, die sich an ihnen bedienen. Die meisten bringen ihre Lernutensilien komplett mit, Lehrbuch, Laptop, Collegeblock; die Bibliothek ist ein modernes Büro, in Ruhe und weniger einsam kann man hier lernen als zuhause, sehen und gesehen werden, Kaffeepausen mit seinen Kommilitonen genießen. Die Kontrolle am Eingang ist deswegen nicht minder streng – man munkelt es gäbe wirklich Studenten, die versuchen würden, Journals aus der Bib zu schmuggeln!
Wie haben die das früher nur gemacht?
Das Lernen ist heute interaktiv. Sobald ich einen Begriff nicht kenne, klicke ich ihn an und lass ihn mir erklären, geht das nicht, google ich ihn kurz. Es gibt kaum ein Thema, zu dem Doccheck, Youtube oder Wikipedia nicht weiter wüssten! In der Forschung ist es genauso, die Pubmed-Recherche liefert mir, richtig angewandt, in Sekundenschnelle relevante Journalartikel, die ich im Handumdrehen in meine Endnote-Bibliothek importiere. Dank meiner intelligenten Ordern sortieren sich die Artikel sogar selbst! Meine Mutter erzählt noch, wie sie sich interessante wissenschaftliche Zeitschriften einzeln aus den Regalen gesucht, den Artikel nachgeschlagen, überflogen, alles was für wichtig empfunden kopiert hat. Was für ein Zeitaufwand!
Wir haben es doch richtig leicht. Oder?
Wir Studenten von heute sind verwöhnt, aber mehr Freizeit haben wir (glaube ich) dennoch nicht als unsere Eltern oder vorangegangene Medizinergenerationen. Die Zeit passt sich an, es wird mehr verlangt (Hypothese! Was meint ihr?), und schließlich geht es wie immer darum, in der Gauß’schen Notenverteilung seines eigenen Semesters möglichst weit rechts zu stehen. Und jeder hat heutzutage Internet. Aber beeindruckend ist es, wie schnell sich Dinge verändern, und dass ich sogar einer junge Assistenzärztin (Examen vor 5 Jahren?) das Amboss-Prinzip erklären muss, lässt mich grübeln. Wie die Zeit vergeht!
Zur Miktionssynkope
Ach ja – so richtig viel konnte Amboss mir dazu leider nicht beibringen, aber nach kurzer Recherche weiß ich mehr: Besonders nach Alkoholkonsum und direkt nach dem Aufstehen aus dem wollig-warmen Bett kann es beim Pipi machen zu Bewusstseinsverlust kommen – Grund ist der plötzlich abnehmende Druck im Unterbauch, der zu einem fallenden Blutdruck führen kann, sowie die Entspannung des gesamten Körpersystems, um das Urinieren zu ermöglichen. Fun Fact: besonders Segler sind gefährdet, an der gefährlichen Synkope zu sterben, wenn sie beim Entleeren ihrer oft übervollen Blase unfreiwillig über Board gehen. Unbedingt als mögliche Todesursache im Hinterkopf behalten, falls ihr mal eine Wasserleiche mit entblößtem Genitale findet! (Übrigens: Wäre das nicht eine fabelhafte Idee für einen Tatort?)
Zizis
Heute war ich gleich bei drei „Zizi“-Operationen dabei, wie die Zirkumzision / Beschneidung hier unter dem Personal genannt wird. Als ich die Abkürzung und ihre Bedeutung kennen lerne, muss ich schmunzeln, heißt „zizi“ auf französisch doch umgangssprachlich Penis (allerdings mit weichem „z“ gesprochen). Der Eingriff geht schnell, ich darf assistieren, und beim dritten Mal weiß ich schon recht genau, welche Schritte aufeinander folgen.
Die Indikation der drei operierten Kinder ist dieselbe: Phimose, eine Vorhautverengung. Bei kleinen Kindern entwickelt sich diese oft noch zurück, geschieht dies jedoch nicht, ist eine Beschneidung angeraten, um Infektionen und Schmerzen bei der Erektion vorzubeugen. Auch das Risiko für Peniskarzinom und Harnwegsinfekte wird durch den Eingriff verringert.
Geschmäcker sind verschieden
Den Vater des ersten Kindes hab ich morgens noch kurz gesehen – er bat darum, auf die vollständige Beschneidung zu verzichten, falls möglich; aus kosmetischen Gründen (Alternative: eine Vorhauterweiterung mit Teilerhalt der Vorhaut). Die Eltern des zweiten Patient dagegen wünschten, dass möglichst viel der Vorhaut wegkommt; ein „high and tight“ beschnittener Penis sei besonders bei Muslimen präferiert, erklärt mir der Arzt. Ich wusste gar nicht, dass es hier unterschiedliche Vorlieben und damit auch OP-Methoden gibt!
Nachmittags in der Sprechstunde sehe ich gleich drei weitere Jungen, die von ihren Eltern zur OP-Indikation Zirkumzision vorgestellt werden. Ein Junge ist noch zu klein, hier rät die Ärztin vorerst zur lokalen Therapie mit Cortisonsalbe, es sei einen Versuch wert, das Problem konservativ zu lösen. Der zweite Junge hat diese Behandlung bereits hinter sich, erfolglos, er bekommt einen OP-Termin. Und der Dritte?
Andere Motive
„Ihr Sohn hat keine Vorhautverengung, das können wir nicht machen. Wir dürfen diese OP hier nur durchführen, wenn eine medizinische Indikation besteht, und diese kann ich bei Ihrem Sohn nicht feststellen.“, erklärt die Ärztin den Eltern (türkisch? arabisch?), die enttäuscht kucken. Eine Praxis habe sie bereits abgewiesen, weil der Sohn Autist sei und er deswegen keine Narkose vertrage, jetzt wüssten sie nicht weiter. Man merkt, dass den Eltern das Anliegen wichtig ist. Seufzend schreibt die Ärztin die Adresse eines niedergelassenen Kollegen auf, „Ihr Sohn ist gesund, er hat nur eine Wahrnehmungsstörung, das spielt keine Rolle für die Narkose. Wenden Sie sich an diesen Kollegen, der wird das machen.“
Zizi-Fakten
Mich beschäftigt das Thema, und abends google ich ein bisschen: Wusstet ihr, dass die WHO die Beschneidung in Ländern mit hoher HIV-Prävalenz als Teil der Anti-AIDS-Strategie empfiehlt? Denn laut drei randomisiert-kontrollierten Studien nimmt die Ansteckungsgefahr bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr nach Beschneidung um ca. 60% ab. Und dass nicht nur die meisten Muslime ihre Söhne beschneiden lassen, sondern auch Juden, und zwar schon am 8. Lebenstag? Überrascht hat mich außerdem, dass auch in den USA sehr viele Babys beschnitten werden – 2005 waren es 56% aller männlichen Neugeborenen, die das Krankenhaus ohne Vorhaut verließen, im Mittleren Westen waren es sogar bis zu 75%. Wieder etwas Neues gelernt!
Link zur WHO-Empfehlung von 2007
Gedanken über die (Studenten-) Zeit
Es regnet draußen, es ist grau, kalt und ungemütlich – so richtiges Novemberwetter. Nach Monaten voll Aktivität (Doktorarbeit, Unikurse, Famulaturen, Nebenjob, PJ-Planung, Urlaub) habe ich heute NICHTS vor, jedenfalls bis 17h. Das ist nur noch selten der Fall, denn selbst wenn keine Verpflichtungen rufen, organisiere ich mir meist ein Freizeitprogramm, muss Haushaltsaufgaben erledigen, bin verabredet oder verbringe Zeit mit meinem Freund. „Langeweile muss sein, das brauchen Kinder“, hat meine Oma früher gesagt. Ich glaube, für Erwachsene gilt das genauso! Und genieße meinen Müßiggang.
Studentenzeit
Als Student hat man viel Zeit – zwischen Vorlesungen Kaffee zu trinken ist meist drin, Veranstaltungen können ausgelassen werden („Kannst du morgen für mich unterschreiben?“), kein Vertrag bindet einen, morgens im Büro / auf Station / im Labor zu erscheinen, auch unter der Woche kann ausgeschlafen werden. Das ist richtig. Andererseits ist das Leben bestimmt vom Stunden- und Semesterplan, ein Lerntag ist erst vorbei, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, und vor einer Klausur ist Wochenende meist gleichbedeutend mit Bib-Zeit. Nebenbei muss Geld verdient und an der Doktorarbeit gearbeitet werden, und die Familie will, dass man sich regelmäßig blicken lässt.
Dennoch – ich genieße es, Studentin zu sein. So intensiv wie jetzt werde ich die Zeit wohl nie mehr erleben. Und das liegt vor allem an der Abwechslung, die wir Studierende genießen: Kurs A, Kurs B, Kurs C, jedes Mal in einer anderen Klinik, täglich neuer Input, dann Klausurenzeit und fette Party, Semesterferien. Neue WG. Fünf Wochen reisen. Auslandssemester, Famulatur in der Hauptstadt, wieder zurück, Kurs D, E und F. Doktorarbeit – neue Leute, neues Umfeld, neue Erfahrung. Endspurt, noch eine Famulatur bei der Familie (zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!), Kurs G und H, dann die Examensvorbereitung. Schließlich das PJ, es zieht uns deutsche Studenten in die Schweiz, nach Frankreich, in die USA. Wo will ich am liebsten hin? Für die Schweiz sind schon alle Plätze weg? Stress – eindeutig ein Wohlstandsproblem, ich weiß.
Zeitgefühl
Mit all dem ist es für mich bald vorbei. Vor mir liegen jetzt noch der 100-Tage Examens-Lernplan, den Amboss so nett für mich strukturiert hat. Anschließend kommt das PJ, das wie im Fluge vergehen wird, und der Berufseinstieg. Ich freue mich darauf, mein Wissen dann anwenden zu können, anzukommen in einem festen Team, Verantwortung zu übernehmen, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, bezahlt zu werden für meine Haupttätigkeit und nicht meinen Aushilfsjob. Aber die Abwechslung des Studentenlebens – die werde ich dann, im Arbeitsalltag, vermissen. Da bin ich mir sicher
Thomas Mann über die Zeit
In seinem Roman „Der Zauberberg“ hat Thomas Mann einen sehr interessanten Abschnitt über das Zeitgefühl und den Zusammenhang zu neuen Orten geschrieben, den ich gerne mit euch teile. Ich habe ihn vor drei Jahren das erste Mal gelesen, und muss immer wieder über seine kluge Beobachtung nachdenken.
„Über das Wesen der Langeweile sind vielfach irrige Vorstellungen verbreitet. Man glaubt im ganzen, daß Interessantheit und Neuheit des Gehaltes die Zeit »vertreibe«, das heißt: verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Das ist nicht unbedingt zutreffend. Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick und die Stunde dehnen und »langweilig« machen, aber die großen und größten Zeitmassen verkürzen und verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit. Umgekehrt ist ein reicher und interessanter Gehalt wohl imstande, die Stunde und selbst noch den Tag zu verkürzen und zu beschwingen, ins Große gerechnet jedoch verleiht er dem Zeitgange Breite, Gewicht und Solidität, so daß ereignisreiche Jahre viel langsamer vergehen als jene armen, leeren, leichten, die der Wind vor sich her bläst, und die verfliegen. Was man Langeweile nennt, ist also eigentlich vielmehr eine krankhafte Kurzweiligkeit der Zeit infolge von Monotonie: große Zeiträume schrumpfen bei ununterbrochener Gleichförmigkeit auf eine das Herz zu Tode erschreckende Weise zusammen; wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer; und bei vollkommener Einförmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden und unversehens verflogen sein. Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch ein Mattwerden des Zeitsinnes, und wenn die Jugendjahre langsam erlebt werden, das spätere Leben aber immer hurtiger abläuft und hineilt, so muß auch das auf Gewöhnung beruhen. Wir wissen wohl, daß die Einschaltung von Um- und Neugewöhnungen das einzige Mittel ist, unser Leben zu halten, unseren Zeitsinn aufzufrischen, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Dies ist der Zweck des Orts- und Luftwechsels, der Badereise, die Erholsamkeit der Abwechslung und der Episode. Die ersten Tage an einem neuen Aufenthalt haben jugendlichen, das heißt starken und breiten Gang, – es sind etwa sechs bis acht. Dann, in dem Maße, wie man »sich einlebt«, macht sich allmähliche Verkürzung bemerkbar: wer am Leben hängt oder, besser gesagt, sich ans Leben hängen möchte, mag mit Grauen gewahren, wie die Tage wieder leicht zu werden und zu huschen beginnen; und die letzte Woche, etwa von vieren, hat unheimliche Rapidität und Flüchtigkeit. Freilich wirkt die Erfrischung des Zeitsinnes dann über die Einschaltung hinaus, macht sich, wenn man zur Regel zurückgekehrt ist, aufs neue geltend: die ersten Tage zu Hause werden ebenfalls, nach der Abwechslung, wieder neu, breit und jugendlich erlebt, aber nur einige wenige: denn in die Regel lebt man sich rascher wieder ein, als in ihre Aufhebung, und wenn der Zeitsinn durch Alter schon müde ist oder – ein Zeichen von ursprünglicher Lebensschwäche – nie stark entwickelt war, so schläft er sehr rasch wieder ein, und schon nach vierundzwanzig Stunden ist es, als sei man nie weg gewesen, und als sei die Reise der Traum einer Nacht.“
Im OP
Vor dem OP habe ich Ehrfurcht. Es gelten besondere Regeln, oft herrscht ein rauher Umgangston; man muss penibel darauf achten, sich von sterilen Wägen mit Instrumenten entfernt zu halten, oder aber unsterile Orte meiden (sobald man steril ist). Beim Waschen haben die Hände höher zu sein als die Ellenbögen, damit kein Desinfektionsmittel von den unsterilen Oberarmen in Richtung Hände läuft; bevor der sterile Kittel angezogen ist, sind die Ellenbögen vom Körper entfernt und die Hände in Brusthöhe zu halten. Den Nasenschutz darf man sich mit sterilen Handschuhen nicht mehr zurecht ziehen (und sich auch nirgendwo im Gesicht jucken, was oft sehr unangenehm sein kann…), und falls etwas vom Tisch rutscht, sollte man es bloß nicht aufhalten (ab einer bestimmten Höhe wird der Sterilität des Kittels und Abdecktuchs nicht mehr getraut). Sobald man den Raum betritt, stellt man sich mit lauter Stimme vor und grüßt, sonst ist man schnell unten durch bei den OP-Assistenten, die Schüchternheit und Unsicherheit mit Arroganz verwechseln.
Ich bin schon fast Expertin
Heute fällt mir auf, wieviele dieser Regeln ich inzwischen schon verinnerlicht habe. Bei der ersten OP, der Reposition eines Leistenbruchs, durfte ich assistieren, und die nette Assistenzärztin, die mich diese Woche unter ihre Fittiche genommen hat, hat mich sogar die Hautnaht machen lassen! Jetzt, bei der zweiten OP, soll die Studentin aus dem 7. Semester mit an den OP-Tisch. Erst einmal hatte sie sich zuvor eingewaschen, und so ist sie sehr erleichtert, als ich mit ihr in den Waschraum gehe und ihr noch einmal erkläre, worauf sie achten muss.
Einen offenen Bauch vor sich zu haben, ist gewöhnungsbedürftig
Was für die Ärzte und OP-Pfleger Alltag ist, ist für Studenten durchaus nicht immer leicht zu verdauen: das erste Mal bei einer großen Operation zu assistieren, die lebenden Organe eines Patienten vor sich liegen zu haben und anzufassen, den glibschigen, warmen Darm festzuhalten und dabei seine Bewegungen zu spüren, oder sogar eine blutig spritzende Arterie zu sehen – das alles ist gewöhnungsbedürftig. Natürlich, nach dem Präp-Kurs in der Vorklinik kennen wir die Anatomie eines Menschen, aber das Ganze bei einem lebenden Patienten vor sich zu haben, ist etwas anderes.
Darüber gesprochen wird selten. Ich mache es heute anders: „Und falls dir schwindelig wird oder so, sag einfach Bescheid, dann trittst du ab und kannst dich hinsetzen. Das ist mir letzte Woche auch passiert und alle waren total nett, das ist vollkommen ok. So lange du nicht am Tisch umkippst, nimmt dir das keiner übel.“ Die Studentin lächelt mich dankbar an. Auch ihr sei schon einmal schwindelig geworden, wir teilen also eine Schwäche – oder eher menschliche Züge? Jetzt geht sie los in den OP, und ich in die Ambulanz, denn zu viert (Oberärztin, Assistenzärztin + zwei Studentinnen) wird es zu eng am OP-Tisch.
Als ich sie am nächsten Morgen sehe frage ich, wie es lief. „Sehr gut“, strahlt sie. Sie konnte sogar etwas helfen, und keinerlei Schwindel sei aufgetreten. Wir lächeln uns an. Und folgen den Ärzten zur Visite. Nachher gehen wir wieder zusammen in den OP: Jeden Tag mit ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit.
Kindercharaktere und ärztliche Kunst
Wie unterschiedlich Kinder schon im jungen Alter sind, sieht man im Krankenhaus besonders deutlich. Kaum ein Kind geht gerne zum Arzt, und Erziehung und Temperament kommen in unangenehmen Untersuchungssituationen besonders zu Vorschein. Oft eine herzzerreißende Angelegenheit, manchmal aber auch unangenehm und anstrengend für das ärztliche Personal…
Ein kleiner Held
Der 18 Monate alte Jonathan kommt zum Verbandswechsel. Vor zwei Monaten hat er sich den Finger in der Tür geklemmt, ein recht großer Weichteildefekt mit kleiner Amputation am Ringfinger (ein Stückchen Finger fehlte), wurde versorgt. Nun ist er mit seinem sympathischen Papa, einem jungen Mann Anfang 30 (Lehrer? Sozialpädagoge?) wieder da.
Todernst blickt unser kleiner Patient aus großen Kinderaugen. Er sitzt bei seinem Vater auf dem Schoß, und im Moment scheint es ihm nichts auszumachen, dass wir uns ihm nähern. Als die Ärztin langsam beginnt, den Verband an seiner Hand abzuwickeln, schaut er argwöhnisch, lässt es sich aber ohne Wehr gefallen. Mindestens fünf Minuten dauert es, bis der Verband vollständig gelöst ist, nun machen wir uns an das Pflaster, das direkt auf der Wunde liegt. Das tut jetzt weh!
Immer kritischer beäugt Jonathan die Ärztin, die nun seine Hand in Wasser taucht, um den Pflasterkleber etwas zu lösen. Aber tapfer hält er still. Zwischendurch schließt er seine Augen, ganz fest, wie um sich zu sagen, dass das jetzt noch durchgestanden werden muss, es aber bald vorbei ist! Ist es möglich, dass der 1,5jährige das schon so versteht?
Als wir fast fertig sind, reicht es Jonathan, leise läuft ihm eine Träne über die Wange, dann fängt er an, in sich hinein zu schluchzen. Aber noch immer hält er tapfer still, wartet, bis die Tortur überstanden ist. Was für ein tapferer, lieber Junge!
Kaum zu bändigen
Über den zweijährigen Milo hingegen wurde uns schon in der Morgenbesprechung berichtet – er zeige regelmäßig selbst- und fremdverletzendes Verhalten (Ich dachte morgens, ich hätte mich verhört und es wäre 12 gemeint…). Nun ist er am Vortag gestürzt und zur Überwachung im Krankenhaus (Gehirnerschütterung?). Davon, dass wir zur Visite zu fünft in sein Zimmer kommen, zeigt sich Milo wenig beeindruckt. Wie ein kleiner Wirbelwind turnt er auf dem Bett herum, nur schwer lässt er sich von seiner Mutter bändigen, damit wir ihn untersuchen können.
Kurz scheint er an der Ärzteschaft Interesse zu haben, doch dann wird es ihm zu langweilig, er windet sich, kreischt, kneift seine Mutter in die Schulter, fängt an, in unsere Richtung zu spucken… dieser Junge hat bestimmt noch eine aufregende Schulkarriere vor sich!
Der Träumer
Dem Vierjährigen José begegne ich nachmittags in der Sprechstunde – er hatte eine Wunde an der Schulter, die per Naht versorgt worden war, und bei dem die Fäden nun aus der Haut austreten. Es ist nicht viel zu tun – die Ärztin desinfiziert die Narbe und zieht zwei kleine Fadenreste – doch José hat keine Lust, sich behandeln zu lassen. Hat er vielleicht schlechte Erinnerungen an die Notaufnahme oder unsere weißen Kittel?
Aber seine Mutter kennt ihn – in beruhigendem Flüsterton erzählt sie ihm die Geschichte von „Cenicienta“ (spanisch, Aschenputtel). Sobald sie hierbei unterbrochen wird, weil die Ärztin eine Frage hat oder José seine Körperhaltung etwas ändern soll, fängt dieser an zu quengeln. Solange er die Geschichte hört, ist er wie in einen Bann versunken und lässt uns in Ruhe arbeiten. Noch beim Anziehen und Herausgehen erzählt seine Mutter weiter, erst auf dem Flur, als ihm sein großer Bruder entgegen läuft, erwacht José aus seiner privaten Märchenstunde.
Ein guter Arzt sein heißt, sich an seine Patienten anzupassen
Wir können uns unsere Patienten nicht aussuchen, und so müssen sich Ärzte an die unterschiedlichen Charaktere anpassen. Bei den Erwachsenen ist es der Sprachkodex, den man wählt, um eine Diagnose zu erläutern; bei den Kindern die Anwendung / Auswahl einer geeigneten Ablenkungsmethode und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Immer mehr beobachte ich, wie wichtig dieser Teil der ärztlichen Tätigkeit ist – ohne die Fähigkeit, die Patienten zum reden zu bringen / eine Atmosphäre zu schaffen, in der das Kind sich untersuchen lässt, hilft die beste Fachkenntnis nichts.
Willkommen in der Medizin, einer sozialen Naturwissenschaft!
In der Kinderchirurgie
Visite: Wir machen uns auf unseren morgendlichen Rundgang und schauen nach unseren kleinen Patienten. Nach denen, die wir in den letzten Tagen operiert haben, nach denen, die mit Beschwerden kamen und zur Überwachung im Krankenhaus sind, und denen, die heute operiert werden sollen.
Zuerst ist der kleine Niklas dran. Der eigentlich bei den Kinderärzten (nicht Chirurgen) untergebrachte Dreijährige hatte eine Purpura Schönlein Henoch, eine nach Infekten auftretende Entzündung der kleinen Gefäße durch Immunkomplexablagerungen. Die Kinder haben einen Hautausschlag, oft auch Gelenk-, Bauchschmerzen und eine Nierenbeteiligung. Bei Niklas kam noch ein entzündeter Lymphknoten am Hals dazu, in dem sich Eiter gebildet und abgekapselt hatte (Abszess). Treu nach dem Jahrtausende alten Lehrsatz des Hippokrates: Ubi pus, ibi evacua – „Wo Eiter ist, lass ihn ab“ hatten wir den Abszess am Vortag im OP gespalten.
Wir machen uns unbeliebt
Nun muss der Verband gewechselt werden. Niklas weiß sofort, worum es geht, und windet sich, als wir seine Mutter und ihn mit in den Verbandsraum nehmen. Ich muss herhalten als Kinderkopfhalterin, und mein Oberarzt löst schnell das Pflaster, tauscht die alte gegen die neue Lasche aus, die in die offene Abszesshöhle gesteckt wird, damit noch vorhandener Eiter ablaufen kann; ein neues Pflaster, und schon sind wir fertig.
Der kleine Eingriff hat keine zwei Minuten gedauert. Niklas ist dennoch bitterböse und kuckt uns aus wütenden Kinderaugen an. Besonders mein Oberarzt erntet hasserfüllte Blicke. „Der weiß genau, wer der Aggressor war“, lautet sein schmunzelnder Kommentar. Aber die Mutter ist froh, als sie erfährt, dass die Wunde komplett reizlos aussieht und der nächste Verbandswechsel beim Kinderarzt stattfinden darf. Sie dürfen nach Hause!
Der nächste kleine Patient ist der achtjährige Fabian, der gestern mit Verdacht auf Blinddarmentzündung kam. Heute soll er operiert werden, hoffentlich bald. Wir erklären den Eltern, dass wir Fabian als Notfall im OP angemeldet haben, und es maximal noch sechs Stunden bis zur Operation dauern sollte. Die ganze Familie ist sichtlich erleichtert. Endlich geht es los!
Interdisziplinarität in der Medizin
Nun gehen wir zu Mamadou. Das drei Monate alte Baby kam mit einer Ösophagusatresie auf die Welt: seine Speiseröhre war auf dem Weg zwischen Rachen und Magen unterbrochen. Schon einige Wochen vorher waren die beiden blinden Enden wieder zusammengenäht worden, doch da Mamadou nicht genug trank und deswegen nicht genug an Gewicht zunahm, hatten wir ihm vor zwei Tagen eine PEG-Sonde angelegt. Jetzt bekommt er nachts ergänzend Nahrung über die Sonde, die durch die Bauchdecke direkt in den Magen führt.
Als wir in das Zimmer kommen, sieht Mamadous Mutter nicht sehr glücklich aus. Ihr Sohn habe sehr viel geweint und ihm gehe es nicht gut. Wir untersuchen den Jungen. Mit dem Bäuchlein ist mein Oberarzt sehr zufrieden, und auch ich taste das weiche Abdomen ab. Aber verschnupft ist der kleine Patient, und bei der Auskultation hören wir deutliche Rasselgeräusche. Wir melden ein Röntgen an, um eine Lungenentzündung auszuschließen, außerdem ein Konsil bei den Kinderärzten. Sie sollen sich das Baby auch nochmal anschauen – Teamwork in der Medizin.
Dann klingelt das Telefon meines Oberarztes, das erstaunlicherweise lang ruhig geblieben ist. „Wir müssen in den OP.“ Wir erklären Mamadous Mutter schnell das weitere Vorgehen und los geht es. Die anderen Patienten müssen sich noch eine Weile gedulden.
Walking in the Suburbs
Langsam gehen wir durch die Straßen des Garden Districts, das reiche Villenviertel von New Orleans. Ein herrschaftliches Haus reiht sich neben das andere, und durch große Hecken hindurch lassen sich Blicke auf fein angelegte Blumengärten, große Rasenflächen und Swimming Pools erhaschen. Große, schöne Bäume spenden angenehmen Schatten, der uns in der prallen Sonne gelegen kommt.
Auf den Spuren des Benjamin Button
Aus dem 19. Jahrhundert stammen die Häuser, die damals von wohlhabenden Amerikanern gebaut wurden. Die Stadt wuchs, und so mussten ehemalige Plantagen neuen Wohnvierteln weichen. Zunächst hatte jede Familie einen riesigen Garten, doch nach und nach wurden mehr und mehr Häuser zwischen die bereits stehenden Villas gesetzt. So ist die Architektur der Gegend äußerst abwechslungsreich. Dies erkannte auch Brad Pitt, der sich 2007 persönlich dafür einsetzte, dass „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ in einem der Häuser gedreht werden konnte.
Ein seltsamer Kontrast zu den gepflegten, reichen Anwesen ist die Straße, die mit großen Rissen, Schlaglöchern und fehlenden Pflastersteinen an Hurricane Katrina erinnert. Obwohl dieser Teil der Stadt im Verhältnis zu anderen Gebieten kaum überflutet war, lässt sich an den Straßenschäden die Gewalt des Sturms erkennen. An den Häusern hinterließ vor allem der Wind große Schäden, die jedoch von seinen Bewohnern längst behoben sind.
Wenn die Bildungsfrage eine Frage des Geldbeutels ist
In der benachbarten Tulane University, einer großen, prestigeträchtigen, privaten Einrichtung, treffen wir eine frisch gebackene Ethnologie-Absolventin. Sie ist gerade dabei, mit ihren Eltern Fotos auf dem schönen Campus zu machen. Ihr Vater ist interessiert, als er hört, dass wir aus Europa kommen, anerkennend nickt er, als wir uns als Medizinstudenten vorstellen. Er komme aus Houston, und gerne besuche er seine Tochter hier in New Orleans, so schön ruhig sei es auf dem Tulane Gelände, und auch die Altstadt und die Musik gefallen ihm sehr gut. Schnell sind die letzten Jahre vergangen, schon sei seine Töchterchen fertig mit dem Studium! Naja, wenigstens müsse er ab jetzt keine teuren Studiengebühren mehr bezahlen… Dass wir in Deutschland kostenlos Medizin studieren (seine erste Reaktion war: „You guys study medicine? Very good, it’s a wonderful job, but the studies are so long, very expensive…“) kann die Familie kaum glauben. Sie haben hart gearbeitet, um ihrer Tochter diese Chance zu ermöglichen, und wahrscheinlich müssen auch noch jahrelang teure Kredite abbezahlt werden.
Zur Info: 70% der amerikanischen Studenten haben nach dem College Schulden von durchschnittlich fast 30.000 Dollar. An der teuren Tulane University dürften es deutlich mehr sein, und für angehende Mediziner sowieso… denn eins von vier Jahren Med School kostet hier rund 80.000 Dollar. Dagegen unsere Semestergebühren von knapp 150 Euro…

Piano Bar
Den Begriff Piano Bar kenne ich schon lange, aber eine wirkliche Vorstellung davon bekomme ich heute Abend: In einem Irish Pub stehen sich zwei Flügel gegenüber, und abwechselnd bringen ein Pianist und eine Pianistin ihr Können zum Besten. Wir dürfen unsere Songwünsche auf Servietten schreiben, und mit ein paar Dollars gespickt landen diese dann bei den Künstlern. Wann kommt endlich unser Song, Piano Man? Wieso gibt es so etwas nicht auch in Deutschland?
Neben uns sitzt ein junges Paar aus New Orleans, er will Pilot werden, sie arbeitet als Visagistin bei Hochzeiten. In herzlicher amerikanischer Art werden uns Drinks bestellt, und plötzlich sind wir wieder beim Thema Studiengebühren, wieder schauen wir in ungläubige Augen, als wir erklären, dass man für die Uni in Deutschland nichts zahlt… Dabei sollte das doch eine Selbstverständlichkeit sein.

NOLA
Die Altstadt von New Orleans („French Quarter“) ist wunderschön: Häuser im Kolonialstil mit gusseisernen Balkonen und bunten, blühenden Blumen zieren die schmalen Straßen, alte Laternen ergänzen das historische Stadtbild und große Holzverandas zieren die stattlichen Villen in der „Esplanade“, welche die Grenze zum Stadtteil Faubourg Marigny bildet. Doch was NOLA wirklich auszeichnet, ist die Lebensfreude, die einem von allen Ecken entgegen spring: Überall spielen Straßenmusiker und Kleinkünstler sind am Werk; eine Blaskapelle begleitet eine Hochzeitsgesellschaft, die zum Umzug durch die Stadt zieht; eine alte Frau animiert Passanten im rosa Hasenkostüm zum Mitmach-Tanz (da mache ich natürlich mit!); ein Pferd spielt Gitarre; Scharen von gut gelaunten, betrunkenen Touristen ziehen durch die Bourbon-Street, die hiesige Partymeile; und egal in welche Bar wir schauen, überall spielen Bands: Rock, Jazz, Brass, Funk, Piano! Überwältigend!
Davon, dass New Orleans vor gut zehn Jahren von einer Jahrhundert-Naturkatastrophe heimgesucht wurde, merkt man hier nichts. Und doch: Hurrikan Katrina hat einschneidende Veränderungen bewirkt, und ganz wird sich NOLA davon wohl nie erholen. Hautnah sind wir mit den Auswirkungen des Sturms in Treme konfrontiert, dem Viertel, das in den letzten Jahren durch die gleichnamige HBO-Fernsehserie bekannt geworden ist*. Nur durch eine Straße vom French Quarter getrennt zählt das Viertel zu den Ältesten der Stadt. Schon immer haben hier vor allem farbige, freie Menschen gewohnt, zu Zeiten der Sklaverei trafen sich die Menschen am arbeitsfreien Sonntag auf dem heutigen Louis Armstrong Platz zum Musizieren. Als wichtiges Zentrum für die lokale afroamerikanische und kreolische (Musik-) Kultur spielt es eine wichtige Rolle für die Stadt, bis heute.
Wir schlendern durch das Viertel und bewundern die bunten Häuser, die zwar weniger edel aussehen als in der touristischen Innenstadt, aber gut gepflegt wirken. Ich bleibe stehen, um Flo eine hübsch dekorierte Gartentür zu zeigen, da spricht uns ein Nachbar an. „Do you like it? It’s my work, I am an artist.**“ Wir drehen uns um, der Mann war gerade dabei, sein Auto auszuladen, sein etwa Achtjähriger Sohn hilft ihm.
Wir kommen in’s Gespräch. Vor Katrina sei er Handwerker gewesen, erzählt uns Jean Marcel (anbei: ihr merkt, nicht nur auf den Straßenschildern findet man das Erbe der französischen Kolonialherren 😉 ). Aber nachdem sein Haus – wie alle im Viertel –durch den Hurricane zerstört worden war, musste er sich neu orientieren. Erst einmal Wiederaufbau, und dann die Frage – wie geht es weiter?
Jean Marcel hat einen Weg gefunden, aus der Zerstörung Neues zu schaffen: aus den bunten Einzelteilen der Häuser fertigt er Mosaike an, die dann als Türen, Verzierung oder Kunstwerk verkauft werden. Touristen wie wir, merkt er an, kämen immer öfter in sein Viertel, und außerdem verkaufe er die Werke in der Stadt. Als wir ihm zu seiner Idee und seinem Erfolg gratulieren, verzieht er die Miene. Ja, er habe Glück gehabt, kann es sich leisten, weiter hier in Treme, seinem Viertel, seiner Stadt, zu leben. Aber viele seiner Nachbarn hätten nicht genug Geld gehabt dafür – sie seien bei Verwandten in Texas oder anderen Orten Louisianas geblieben. An schlauen Investoren habe es nach dem Sturm nicht gemangelt. Und die Gentrifizierung habe zwar schon vorher begonnen, sei aber durch die Naturkatastrophe noch verstärkt worden. Wir kucken uns etwas schuldbewusst an, ist unser Spaziergang hier nicht Zeichen dieses Prozesses?
Als wir erzählen, dass wir vor allem aufgrund der Fernsehserie aus Europa hierher gereist sind, grinst er. Ja, ja, die Serie habe ganz schön Trubel verursacht. In seiner Straße hätten sie gedreht! Tja, einerseits cool, sein Haus im Fernsehen zu sehen, andererseits hätten die Film-Trucks auch auf seinem Gründstück gestanden, und bezahlt worden sei dafür nicht. Nur ein paar Menschen des Stadtteils hätten Glück gehabt, durften mitspielen in der Serie und Geld verdienen. Die Gemeinschaft habe nicht profitiert, und immer öfter käme Hollywood jetzt hierher, mit der Ruhe sei es vorbei.
Als ich abends im Reiseführer lese, dass Tremes Schulen von Katrina profitiert haben und inzwischen zu den besten öffentlichen Schulen der Stadt gehören, bin ich erleichtert: Zumindest in einem Bereich scheint alles richtig gelaufen zu sein.
* Wärmstens zu empfehlen! „The Wire“-Schöpfer David Simon und Eric Overmyer zeichnen ein spannendes, sehr realistisches Bild des Viertels und seiner Bewohner. Es geht um die schwierige Rückkehr nach New Orleans und den Wiederaufbau der Stadt, die verschiedenen Interessengruppen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, und den Wunsch, die Seele der Stadt am Leben zu erhalten.
** „Gefällt sie euch? Die hab ich gemacht, ich bin Künstler.“
Getting to New Orleans
Nach einem langen, aber durch In-Flight-Entertainment und unsere Bücher recht kurzweiligen Flug von Frankfurt nach Houston ist es so weit – wir stehen an der Immigrations Control der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit unserer letzten Reise in die USA im Jahr 2012 hat sich einiges verändert: wir passieren eine Station, in der wir selbst unsere Daten eingeben müssen, Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen werden. Doch anscheinend funktioniert das neue System noch nicht einwandfrei, denn im Anschluss passieren wir den traditionellen Zollbeamten.
Wie schon so oft am Zoll bin ich dankbar den deutschen Pass zu besitzen – das Reisen ist so einfach als „Weltbürger erste Klasse“. Für kaum ein Land benötigt man ein Visum; für die USA reicht es, sich bis zu drei Tage vorher online zu registrieren, eine reine Formalität. Wie schwer wurde es im Gegensatz dazu meiner Cousine gemacht als diese uns aus Indonesien besuchen kommen wollte! Aber hierzu ein andermal mehr.
Die Einreiseprozedur dauert länger als erwartet, und so sind wir froh, als wir endlich im Mietauto sitzen. Wir hatten Glück – es gab keinen Wagen in unserer Preisklasse mehr, und so haben wir ein Upgrade, also ein noch größeres Auto, erhalten!
Auf nach New Orleans!
Schon vom Highway aus sieht das Land ganz anders aus als Deutschland: In den USA ist das Land einfach viel weiter als in Europa, und das spiegelt sich nicht nur in fantastischen, riesigen Nationalparks, breiten Straßen, großen Gärten und immer und überall ausreichend Parkmöglichkeiten wider, sondern auch im Straßenbau: An vielen Stellen ist die Gegenfahrbahn nicht durch Leitplanken von unserer getrennt, sondern es gibt einfach einen großzügigen Sicherheitsabstand. Mit maximal 60-70 mph (Ach, die gute alte Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung!) fahren wir in Richtung Osten, denn noch heute wollen wir New Orleans erreichen. Links und rechts passieren wir immer wieder Fast-Food Restaurants und Tankstellen. Auch ein Emergency Room (Notaufnahme) wurde direkt an die Straße gebaut… komisch!
Je näher wir unserem Ziel kommen, desto „feuchter“ wird die Landschaft: NOLA, wie New Orleans liebevoll von seinen Einwohnern genannt wird, liegt mitten im Mississippidelta. Stellenweise steht die Fahrbahn wie auf Stelzen in einer riesigen Sumpflandschaft. Besonders jetzt, bei Sonnenuntergang, eine atemberaubende Kulisse! Ich frage mich, wieso die Menschen überhaupt auf die Idee kamen, an so einem unpraktischen Ort eine Stadt zu errichten, und lese später nach, dass es am Mississippi lag. Als natürliche Wasserstraße bis nach Kanada reichend war sein Zugang höchst umkämpft zwischen den Kolonialmächten, und da scheute man sich nicht einmal davor, eine Stadt unter Meeresspiegelniveau im Sumpf zu errichten. Wahnsinn, wie manchmal Geschichte geschrieben wird…
Endlich am Ziel
Nach fast sechs Stunden Fahrt und hundemüde (in Deutschland dürfte es mittlerweile wieder hell werden) sind wir endlich da. Schnell die Unterkunft finden, Koffer ablegen, und dann geht’s los – wir wollen den Freitagabend dazu nutzen, einer der berühmten Brass Bands zu lauschen, die ganz in der Nähe in der Frenchmen Street spielen!
Durch die Aufregung und den Trubel des New Orleanser Nachtlebens sind wir ruck-zuck wieder topfit. Schnell ist der Club gefunden, den wir suchen, rein da, Bier her, und dann lassen wir uns von den Rhythmen der Rebirth Brass Band verführen.
Brass Bands in New Orleans
Brass Bands haben in New Orleans eine lange Tradition: schon seit dem 19. Jahrhundert ertönen Trompeten, Posaunen, Saxophone, Klarinetten und Perkussioninstrumente in den Straßen der Stadt. Durch die Mischung von afrikanischer Folkmusik, die mit den ehemaligen Sklaven in die USA kam, und europäischen Militärmärschen entstanden hier ein völlig neue Rhythmen. In den 1970er und 80er Jahren kamen dann noch Einflüsse des Funk und Hip Hop dazu, und „although jazz grew up in Chicago and New York, it was born here, in New Orleans“ *, wird uns von einem Local erklärt. Uns geht der Rhythmus in’s Blut, und wir tanzen bis wir nicht mehr können. Genial!
Hier für euch eine kleine Kostprobe:
https://www.youtube.com/watch?v=fhwoGVbY9xU
* “der Jazz ist zwar in Chicago und New York groß geworden, aber geboren wurde er hier, in New Orleans“